Faktencheck: Gegenrede zur Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN): Was sagt die Wissenschaft wirklich über ME/CFS?
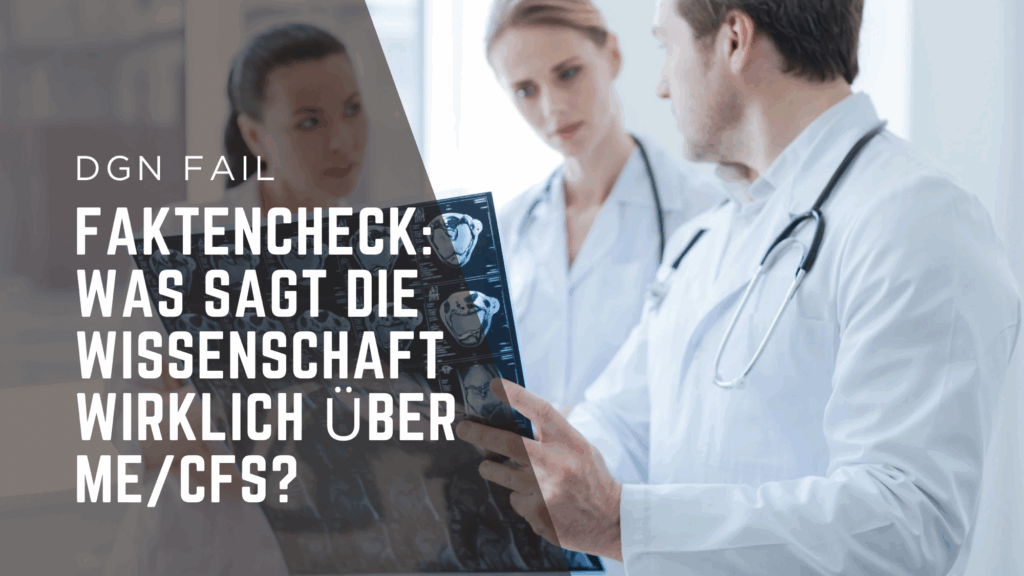
Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie hat eine Stellungnahme zum aktuellen Forschungsstand zu ME/CFS veröffentlicht. Diese weist gravierende Mängel in der Belegführung auf – sprich: weiterführende Quellen fehlen vollständig. Im Folgenden möchte ich diese Stellungnahme mit fundierten Quellen widerlegen.
Hier die Gegendarstellung als PDF herunterladen
Aussage DGN:
„Die Myalgische Enzephalomyelitis / das Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) erfährt aktuell eine besondere politische und mediale Beachtung. Es handelt sich um eine komplexe chronische Erkrankung mit vielgestaltiger Symptomatik, bei der die Diagnostik und Therapie schwierig sind, da Krankheitsmarker oder etablierte Behandlungen fehlen.“
Tatsachen:
In Übersichtsartikeln wird ME/CFS explizit als „neuroimmunological multisystem disease“ beschrieben, mit Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem, das Immunsystem, den Stoffwechsel und das Gefäßsystem.
Komaroff und Bateman (2021) beschreiben ME/CFS als mögliche Folge viraler Trigger mit neuroimmunologischer Pathophysiologie.[1]
Scheibenbogen, C., et al. (2023) belegt immunologische Mechanismen (Autoantikörper, Immundysregulation) bei ME/CFS[2].
Sun et al. (2024) erstellten ein Review zu Immunzellveränderungen und Biomarker-Ansätzen: „Die hier vorgestellten Ergebnisse könnten neue Einblicke in die immunologischen Komplexitäten von ME/CFS bieten. Insbesondere identifizierten wir eine übermäßige Kommunikation, die von Monozyten initiiert und über ESRRA-APP-CD74 an andere Immunzellkomponenten weitergeleitet wurde. Diese Kommunikation könnte als potenzieller Biomarker dienen und die Entwicklung molekulardiagnostischer Instrumente erleichtern.“.[3] Unsere Analyse identifizierte außerdem den Signalweg des Estrogen-Related Receptor Alpha (ESRRA)-APP-CD74 als potenziellen Biomarker für ME/CFS im peripheren Blut. (Sun et al., 2024)
Diese Studie[4] zeigt, dass es neuroimmune Ähnlichkeiten zwischen MS und ME/CFS gibt. Dies untermauert die Ansicht, dass ME/CFS eine neuroimmune Erkrankung ist und dass Patienten mit MS immunologisch anfällig für die Entwicklung von ME/CFS-Symptomen sind. (Morris & Maes, 2013)
Ein Frontiers‑Review[5] betont ein „kompliziertes Geflecht aus genetischen Vulnerabilitäten, viralen Auslösern, Immundysregulation, chronischen Entzündungen, Darmdysbiose und metabolischen Störungen“ (Arron et al., 2024)
Die Studie von Jin-Seok Lee et al. (2024) liefert starke Hinweise auf neuroinflammatorische Prozesse in spezifischen Hirnregionen bei ME/CFS und legt damit einen Grundstein für weiterführende, gezieltere neurobildgebende Forschung.[6]
Patient*innen leiden unter schwersten Symptomen wie Post-Exertional Malaise (PEM) mit deutlicher Verschlechterung nach Belastung, kognitive Einbußen, Orthostaseprobleme, Schmerzen, Reizempfindlichkeit, Infektanfälligkeit bis hin zur Pflegebedürftigkeit. Insgesamt handelt es sich um eine Erkrankung mit hochgradiger Beeinträchtigung. [7] Ein Viertel aller Patient*innen kann das Haus nicht mehr verlassen, viele sind bettlägerig und auf Pflege angewiesen.[8] Schätzungsweise über 60 Prozent sind arbeitsunfähig.[9]
Aussage DGN:
„Fachleute schätzen die Erkrankung bislang uneinheitlich ein: Während ME/CFS von einigen als dramatisch unterdiagnostiziert oder vernachlässigt angesehen wird, stellen andere es als primär somatisch bedingte Erkrankung in Frage.“
Tatsachen:
Dieser Satz ist irreführend, tendenziös und veraltet, da er einen falschen wissenschaftlichen Streit suggeriert, der in dieser Form international längst nicht mehr existiert. Hier die schrittweise Widerlegung mit fundierten Belegen.
ME ist längst international als somatisch-neuroimmunologische Erkrankung anerkannt. Seit 1969 als neurologische Erkrankung (ICD-10: G93.3) klassifiziert. Auch in ICD-11 unter „postviralen Erkrankungen“ – nicht unter psychosomatischen oder funktionellen Störungen.[10]
Führende wissenschaftliche Institutionen bestätigen, dass die Erkrankung real und körperlich ist. US National Academies of Sciences (NAM, vormals IOM), 2015 : „ME/CFS is a serious, chronic, complex, and systemic disease […] It is not a psychological disorder.“[11]
Die These, ME sei „umstritten“ oder „psychisch“ begründbar, ist überholt. Leitlinien und Metastudien belegen eine überwältigende körperliche Grundlage, z. B.: Abnormale Immunparameter (NK-Zellen, Autoantikörper), Entzündungsmarker im ZNS (Neuroinflammation), Energie- und Stoffwechselstörungen (ATP-Produktion, Laktatbildung), Autonome Dysfunktion (z. B. POTS)[12]
Die „Uneinigkeit“ stammt meist aus Deutschland. International hingegen herrscht Konsens über somatische, oft postinfektiöse Grundlage, v. a. seit Long Covid. Dies bestätigt unter anderem der vom Robert Koch-Institut (RKI) 2015 veröffentlichte Bericht zu ME, der im Herbst 2019 wieder von der Website gelöscht wurde. Dieser basierte auf einer Literaturauswertung, die sich auf diskreditierte Verhaltensstudien konzentrierte. Der Bericht enthielt Empfehlungen, die nicht evidenzbasiert und möglicherweise schädlich für Menschen mit Myalgischer Enzephalomyelitis waren.[13]
Es ist auch belegt, dass ME unterdiagnostiziert und vernachlässigt ist. Weltweit wird ME/CFS bei nur einem Bruchteil der Betroffenen korrekt diagnostiziert. Schätzungen zufolge erhalten nur ca. 10–15 % eine Diagnose und die durchschnittliche Diagnoseverzögerung liegt bei 5 bis 7 Jahren. [14]
Aussage DGN:
„Das Thema ist für die Neurologie besonders relevant, da viele Betroffene hier Rat suchen, und erfährt bei der DGN eine wissenschaftlich geprägte hohe Beachtung. Aus neurologischer Sicht ist es problematisch, dass mit dem Begriff der „Enzephalomyelitis“ eine Entzündung des Gehirns und Rückenmarks postuliert wird, die in aller Regel bei „ME/CFS“ nicht nachweisbar ist.“
Tatsachen:
Diese Aussage steht im Widerspruch zur Realität in der deutschen Versorgungslandschaft. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) hat jahrzehntelang keine eigene ME- Leitlinie erstellt, obwohl sie dafür zuständig wäre (ICD-10: G93.3 = neurologisches Krankheitsbild). Die Versorgung durch Neurolog*innen in Deutschland ist laut Betroffenenberichten und Studien katastrophal schlecht. [15] Es kommt häufige zu Fehldiagnosen (z. B. Depression, Somatisierungsstörung), die Symptome werden verbagatellisiert und Pacing sowie PEM wird ignoriert. Die wenigen Forschungsvorhaben stammen überwiegend nicht aus der Neurologie, sondern aus anderen Fachbereichen wie etwa der Immunologie (Charité/Scheibenbogen), Infektiologie und Stoffwechselforschung.
Der Begriff „Enzephalomyelitis“ wurde bereits 1956 von der US-amerikanischen CDC bei der „Royal Free Epidemic“ eingeführt. Er ist offiziell im ICD-10 und ICD-11 als Myalgische Enzephalomyelitis gelistet (G93.3). Vermutlich geht es nicht um akute, im MRT sichtbare Enzephalomyelitis wie bei MS, sondern um chronisch niederschwellige Neuroinflammation, z. B. durch Mikroglia-Aktivierung. Nachweisbare neuroinflammatorische Prozesse wurden in mehreren Studien belegt.
- PET-Studien in Japan (Nakatomi et al., 2014) zeigen Mikroglia-Aktivität im Gehirn von ME/CFS-Betroffenen.[16]
- Magnetresonanztomografie weist strukturelle und funktionelle Veränderungen im Gehirn nach (u. a. reduzierte Durchblutung, gestörte Konnektivität, erhöhter Lactatspiegel)[17]
- Metabolische Auffälligkeiten im Liquor und peripherem Blut lassen auf chronisch neuroinflammatorische Prozesse schließen[18]
Aussage DGN:
„In den letzten fünf Jahrzehnten ist es nicht gelungen, ME/CFS mit Biomarkern wie Blut oder Liquortests oder in der Bildgebung des Gehirns (v. a. MRT) zu identifizieren. …“
Tatsachen:
Beentjes et al. (2025) konnte durch die „Große Biomarker-Studie“ (Edinburgh, 2025) zeigen, dass die ME/CFS-Patienten konsistent von Kontrollen durch 116 Blutmarker unterschieden werden konnten. Einschließlich Entzündungs-, Insulinresistenz- und Leberbefunden.[19]
Außerdem zeigte ein Review in BMC Translational Medicine (2025) vielversprechende biochemische und elektrophysiologische Eigenschaften, die als Blut-Biomarker dienen könnten.[20]
PEM gilt als zentrales Kennzeichen von ME/CFS.[21] Es kann nachgewiesen werden über:
- Hypermetabolismus und gestörte ATP-Produktion in Muskel- und Immunzellen.[22]
- Neuroimaging-Studien während PEM: Veränderungen der Gehirnaktivierung (PET, fMRT)[23]
- mitochondriale und mikrozirkulatorische Dysfunktionen nach Belastung[24]
„Vielgestaltiges Krankheitsbild“ Ja, aber mit physiologischer Erklärung. ME/CFS ist multisystemisch – immunologische, neurometabolische und kardiorespiratorische Veränderungen sind gut belegt (siehe oben). Studien zeigen reproduzierbare Biomarker und physiologische Muster. Wearable-Technologie („UpTime“) liefert objektive, alltagsnahe Maße zur Verlaufsbeurteilung[25]
Auch wenn noch keine zugelassene Biotherapie existiert, gibt es vielversprechende Ansätze wie Immunmodulatoren (z.B. Low-dose Naltrexon) zeigen initiale Wirkung und metabolische Interventionen (z. B. Mitochondrien-Unterstützung) werden ebenfalls intensiv erforscht.
Es braucht viel mehr Forschung statt Stigmatisierung.
Die Argumentation der DGN wirkt veraltet und selektiv. Die DGN ignoriert aktuelle wissenschaftliche Fortschritte bei Biomarkern, physiologischen Mechanismen und vielversprechenden Behandlungsansätzen. Die Behauptungen entsprechen nicht dem heutigen Stand der globalen ME-Forschung.
Quellen:
[1] Komaroff, A. L. & Bateman, L. (2021). Will COVID-19 Lead to Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome? Frontiers in Medicine, 7. https://doi.org/10.3389/fmed.2020.606824
[2] Scheibenbogen, C., et al. (2023). Diagnostic and pathophysiological relevance of autoantibodies in ME/CFS. Frontiers in Immunology, 14, 1386607. https://doi.org/10.3389/fimmu.2024.1386607
[3] Sun, Y., Zhang, Z., Qiao, Q., Zou, Y., Wang, L., Wang, T., Lou, B., Li, G., Xu, M., Wang, Y., Zhang, Z., Hou, X., Chen, L. & Zhao, R. (2024). Immunometabolic changes and potential biomarkers in CFS peripheral immune cells revealed by single-cell RNA sequencing. Journal Of Translational Medicine, 22(1). https://doi.org/10.1186/s12967-024-05710-w
[4] Morris, G. & Maes, M. (2013). Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and encephalomyelitis disseminata/multiple sclerosis show remarkable levels of similarity in phenomenology and neuroimmune characteristics. BMC Medicine, 11(1). https://doi.org/10.1186/1741-7015-11-205
[5] Arron, H. E., Marsh, B. D., Kell, D. B., Khan, M. A., Jaeger, B. R. & Pretorius, E. (2024). Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: the biology of a neglected disease. Frontiers in Immunology, 15. https://doi.org/10.3389/fimmu.2024.1386607
[6] Lee, J.-S., Ryu, H., Kim, H.-J., Noda, Y., & Lee, T.-Y. (2024).
Neuroinflammatory abnormalities in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: A systematic review and meta-analysis of neuroimaging studies.
Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 158, 105519. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2024.105519
[7] Wikipedia-Autoren. (2004, 1. April). Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom. https://de.wikipedia.org/wiki/Myalgische_Enzephalomyelitis/Chronisches_Fatigue-Syndrom
[8] Carruthers B, van de Sande M (2005), Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: A Clinical Case Definition and Guidelines for Medical Practitioners, An Overview of the Canadian Consensus Document, The National Library of Canada.
[9] Bateman et al. (2014), Chronic fatigue syndrome and comorbid and consequent conditions: evidence from a multi-site clinical epidemiology study, Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior, doi: 10.1080/21641846.2014.978109.
[10] WHO, ICD-10 Version 2019, G93.3 „Postviral fatigue syndrome / Myalgic encephalomyelitis“
https://icd.who.int/browse10/2019/en#/G93.3
[11] Medicine, I. O. (2015). Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic fatigue syndrome. In National Academies Press eBooks. https://doi.org/10.17226/19012
[12] Komaroff, A. L. & Lipkin, W. I. (2021). Insights from myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome may help unravel the pathogenesis of postacute COVID-19 syndrome. Trends in Molecular Medicine, 27(9), 895–906. https://doi.org/10.1016/j.molmed.2021.06.002
[13] MEpedia. (2022, 30. November). Germany – MEpedia. MEpedia. https://me-pedia.org/wiki/Germany
[14] Centers for Disease Control and Prevention (CDC). ME/CFS statistics. https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db488.htm
[15] Hattesohl, D., Musch, S., Thoma, M. & Deutsche Gesellschaft für ME/CFS e.V. (2019). Stellungnahme zum Vorbericht. In Dokumentation der Anhörung Zum [Berichtsplan / Vorbericht]. Abgerufen am 23. Juli 2025, von https://www.mecfs.de/wp-content/uploads/2022/11/221125_n21-01_stellungnahme_vb_dg-mecfs.pdf
[16] Nakatomi, Y., Mizuno, K., Ishii, A., Wada, Y., Tanaka, M., Tazawa, S., Onoe, K., Fukuda, S., Kawabe, J., Takahashi, K., Kataoka, Y., Shiomi, S., Yamaguti, K., Inaba, M., Kuratsune, H. & Watanabe, Y. (2014). Neuroinflammation in Patients with Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis: An 11C-(R)-PK11195 PET Study. Journal Of Nuclear Medicine, 55(6), 945–950. https://doi.org/10.2967/jnumed.113.131045
[17] Boissoneault, J., Letzen, J., Lai, S., O’Shea, A., Craggs, J., Robinson, M. E. & Staud, R. (2015). Abnormal resting state functional connectivity in patients with chronic fatigue syndrome: an arterial spin-labeling fMRI study. Magnetic Resonance Imaging, 34(4), 603–608. https://doi.org/10.1016/j.mri.2015.12.008
[18] Komaroff, A. L. & Lipkin, W. I. (2021). Insights from myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome may help unravel the pathogenesis of postacute COVID-19 syndrome. Trends in Molecular Medicine, 27(9), 895–906. https://doi.org/10.1016/j.molmed.2021.06.002
[19] Beentjes, S. V., Méharon, A. M., Kaczmarczyk, J., Cassar, A., Samms, G. L., Hejazi, N. S., Khamseh, A. & Ponting, C. P. (2025). Replicated blood-based biomarkers for myalgic encephalomyelitis not explicable by inactivity. EMBO Molecular Medicine. https://doi.org/10.1038/s44321-025-00258-8
[20] Clarke, K. S. P., Kingdon, C. C., Hughes, M. P., Lacerda, E. M., Lewis, R., Kruchek, E. J., Dorey, R. A. & Labeed, F. H. (2025). The search for a blood-based biomarker for Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS): from biochemistry to electrophysiology. Journal Of Translational Medicine, 23(1). https://doi.org/10.1186/s12967-025-06146-6
[21] Wikipedia-Autoren. (2004c, April 1). Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom. https://de.wikipedia.org/wiki/Myalgische_Enzephalomyelitis/Chronisches_Fatigue-Syndrom
[22] McGregor, N. R., Armstrong, C. W., Lewis, D. P. & Gooley, P. R. (2019). Post-Exertional Malaise Is Associated with Hypermetabolism, Hypoacetylation and Purine Metabolism Deregulation in ME/CFS Cases. Diagnostics, 9(3), 70. https://doi.org/10.3390/diagnostics9030070
[23] Pears, K. & ME Association. (2023). POST-EXERTIONAL MALAISE. In RESEARCH REVIEW. https://meassociation.org.uk/wp-content/uploads/2025/02/Research-review-PEM-DECEMBER-2024.pdf
[24] Haunhorst, S., Dudziak, D., Scheibenbogen, C., Seifert, M., Sotzny, F., Finke, C., Behrends, U., Aden, K., Schreiber, S., Brockmann, D., Burggraf, P., Bloch, W., Ellert, C., Ramoji, A., Popp, J., Reuken, P., Walter, M., Stallmach, A. & Puta, C. (2024). Towards an understanding of physical activity-induced post-exertional malaise: Insights into microvascular alterations and immunometabolic interactions in post-COVID condition and myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. Infection. https://doi.org/10.1007/s15010-024-02386-8
[25] Sun, Y., Vernon, S. D. & Roundy, S. (2024b, April 5). System and Method to Determine ME/CFS and Long COVID Disease Severity Using a Wearable Sensor. arXiv.org. https://arxiv.org/abs/2404.04345
Vielen herzlichen Dank für diese Gegendarstellung !!!
Hoffentlich werden diese fundierte Klarstellungen von vielen Neurologen auch verstanden.
Danke liebe Renate, ja, das hoffe ich auch.